Handwerk, Technik und Medizin im Dienst hilfsbedürftiger Menschen
Leistungssportler Markus Rehm stellte zuletzt im August 2018 bei der Para-Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin mit 8,48 Meter einen neuen Weltrekord im Weitsprung auf. Der 30-jährige Orthopädie-Techniker-Meister aus Leverkusen übertraf damit u.a. seinen damaliegen Rekordsprung von 8,21 Meter, der ihm die Goldmedaille der Paralympics 2016 in Rio de Janeiro einbrachte.
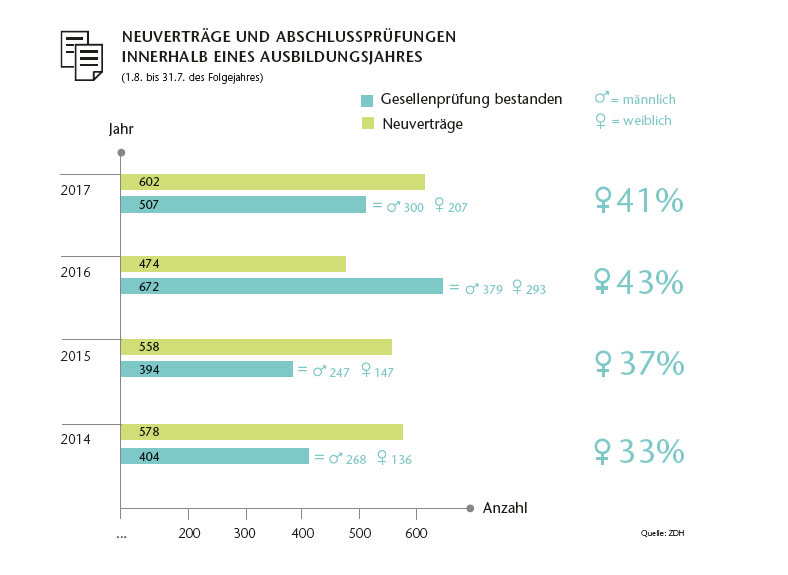
Marcus Rehm verlor infolge eines Bootsunfalls als 14-Jähriger sein rechtes Bein unterhalb des Knies. Seither trägt er eine Prothese und bei seinen sportlichen Aktivitäten eine Karbon-Sportprothese. Neben Prothesen verhelfen auch von Orthopädie-Technikern individuell angepasste Bandagen, Orthesen, orthopädische Einlagen und medizinische Kompressionsstrümpfe Leistungssportlern zu weiteren Höchstleistungen, indem sie Verletzungen verhindern oder zur schnelleren Heilung beitragen. Bestes Beispiel: Der aus Deutschland stammende Basketball-Superstar Dirk Nowitzki setzt auch in seiner mittlerweile 21. NBA-Saison mit den Dallas Mavericks auf individuelle orthopädietechnische Versorgungen.Zwei Geschichten und ein Gesundheitshandwerk, das diese Geschichten maßgeblich mitschreibt: Orthopädietechnik-Mechaniker bzw. Orthopädietechnik-Mechanikerin. Was machen Orthopädie-Techniker? Welche Kompetenzen erwerben sich Auszubildende und welche Voraussetzungen müssen Bewerber für einen Ausbildungsplatz mitbringen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der folgende Text.
Technisches Interesse, handwerkliches Geschick und großes Einfühlungsvermögen
Der Beruf des Orthopädie-Technikers meistert die Schnittstelle zwischen moderner Technik und dem Menschen, indem er Technik, Handwerk und Medizin – inklusive digitaler Verfahrenstechniken – verbindet. Im interdisziplinären Team gemeinsam mit Ärzten und Therapeuten versorgen Orthopädie-Techniker die Patienten mit orthopädietechnischen Hilfsmitteln. Hierzu zählen künstliche Gliedmaßen (Prothesen), stützende und stabilisierende Schienen und Bandagen, die auf dem Körper getragen werden (Orthesen), sowie Gehhilfen und Rollstühle (Rehabilitationstechnik). Am Ende ihrer Ausbildung können Gesellen modernste Hilfsmittel selbst herstellen, industriell vorgefertigte Passteile an Patienten anpassen sowie Patienten und das interdisziplinäre Team beraten. Bewerber für eine Ausbildung zum Orthopädie-Techniker sollten daher Spaß am gewissenhaften Arbeiten, an Naturwissenschaften und handwerklichen Tätigkeiten mit klassischen und modernen Materialien haben sowie ein räumliches Vorstellungsvermögen besitzen. Darüber hinaus sollten sie ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen aufweisen, ohne Berührungsängste vor Narben und Wunden an Körper und Seele der Patienten. Ausbildungsbetriebe empfehlen einen mittleren oder höheren Schulabschluss. Mit einem Hauptschulabschluss erfüllen Bewerber aber ebenfalls die formalen Voraussetzungen. Wer bereits ein (Schul-)Praktikum in einer Orthopädie-Technik-Werkstatt oder einem Sanitätshaus absolviert hat, erhöht seine Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
Dreijährige duale Gesellenausbildung
Die dreijährige Ausbildung zum Orthopädie-Techniker zählt zu den „Dualen Ausbildungen“. Der praktische Teil der Ausbildung wird in einem der nach Angaben des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT) derzeit rund 2.000 Ausbildungsbetriebe vermittelt. Der theoretische Teil erfolgt in einer der bundesweit 13 Berufsschulen (siehe Seite 68).
Ausbildungsverordnung und Rahmenlehrplan in eigener Abstimmung
Die jüngste Novelle der Ausbildungsverordnung stammt vom 15. März 2013. In der aktuellen „Verordnung über die Berufsausbildung zum Orthopädietechnik-Mechaniker und zur Orthopädietechnik-Mechanikerin“ ist die Dauer der Ausbildung auf drei Jahre festgelegt. Sie sieht zudem eine zweiteilige Gesellenprüfung vor und enthält den Ausbildungsrahmenplan, der die Inhalte der betrieblichen Ausbildung bundesweit einheitlich vorgibt. In Deutschland besitzen die Bundesländer die sogenannte Kulturhoheit, sodass jedes Bundesland für die Gesetzgebung für das Schul-, Hochschul- und Erziehungswesen innerhalb seiner Landesgrenzen zuständig ist. Damit sich die Ausbildungsinhalte in den Bundesländern nicht zu sehr unterscheiden und eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Qualitätsstandards gewährleistet wird, erarbeitet die „Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder“ (Kultusministerkonferenz) einen länderübergreifenden Rahmenlehrplan des berufsbezogenen Unterrichts an den Berufsschulen. Mit Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 22. März 2015 trat der bis heute gültige „Rahmenlehrplan Orthopädietechnik-Mechaniker und Orthopädietechnik-Mechanikerin“ in Kraft. Die einzelnen Bundesländer können den Rahmenlehrplan eins zu eins übernehmen. Sollten sie es vorziehen, einen eigenen Lehrplan aufzustellen, muss er sich eng an die Vorgaben der Kultusministerkonferenz anlehnen.
Ergänzende überbetriebliche Lehrlingsunterweisung
Da nicht jeder Ausbildungsbetrieb aufgrund seiner Struktur in der Lage ist, alle Ausbildungsinhalte abzubilden und die neuesten Technologien einzubeziehen, bieten mehrere Kammerbezirke und Landesinnungen für Orthopädie-Technik als dritten Ausbildungsbaustein eine „Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung“ (ÜLU) an.
Von Bandagen über Prothesen bis Rehabilitationstechnik
Der Ausbildungsrahmenplan für den betrieblichen Teil der Ausbildung sieht das Erlangen von berufsprofilgebenden und integrativen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten vor, die ein Orthopädie-Techniker im Laufe der Ausbildung erlangen muss.




